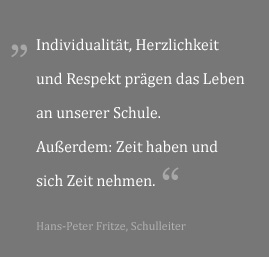Wir Jugendlichen haben's nicht leicht, Digger!
Dieser Artikel wurde am 2.Juni ausgezeichnet. Weitere Informationen hier.
Bloß nicht auffallen, lautet das Motto. Einheitliche Sprache und Kleidungsstil sind wichtig. Fehler werden blitzschnell über soziale Netzwerke zurückgemeldet und weltweit verbreitet.
Wenn ich mich in eine Hamburger U-Bahn, in eine S-Bahn oder einen Bus setze und höre, wie sich Jugendliche miteinander unterhalten, sehe ich, wie ältere Menschen anfangen zu schmunzeln. Das ist noch nett. Andere Ältere sind genervt und beschweren sich über die verwahrloste Sprache der Jugend.
Da sprechen sich Mädchen gegenseitig mit "Junge" an, in jedem Satz kommt mindestens einmal das Wort "Digger" vor, und ständig fällt das Wort "Yolo" als Lebensmotto eines jeden Jugendlichen in unserer Zeit. "Yolo" ist die Abkürzung für den englischen Satz "You only live once": Du lebst nur einmal. Ich frage mich, ob ich mich in 60 Jahren vielleicht auch über die Jugendlichen beschweren werde. "Digger" ist in Hamburg übrigens einfach nur eine Anrede unter Freunden.
Ältere Menschen können, wenn sie uns zuhören, den Eindruck bekommen, dass die Vielfältigkeit der Sprache verloren geht. Aber nicht nur das.
Meine Eltern sagen oft, dass sie den Eindruck haben, dass alle Jugendlichen ähnlich aussehen. Sie meinen, die Jungs tragen die gleichen Frisuren und Klamotten. Ebenso die Mädchen. Früher haben Jugendlichen offenbar deutlicher gemacht, zu welcher Gruppe sie gehören möchten. Da gab es die Punks, die Hippies oder doch die Rock'n'Roller. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet, ob ich und meine Freundinnen uns ähnlich anziehen. Vielleicht haben wir einfach keinen so großen Drang dazu, besonders individuell zu sein oder aufzufallen.
Uns interessiert eher, wie viele "Likes" wir auf Facebook oder "Follower" auf Instagram haben. Mit einem "Like" erfahre ich, ob jemand meinen Eintrag auf Facebook gut findet. "Follower" sind die Leute, die sich meine Fotos auf Instagram anschauen.
Wenn wir in diesen sozialen Medien öffentlich machen, dass wir anders sein wollen, dann wissen das nicht nur meine Mitschüler. Nein, das Internet vernetzt uns mit der ganzen Welt, und dann weiß das die ganze Welt. Wenn wir im Internet einen Fehler machen, dann können die Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, das jeden wissen lassen. Also wollen wir nicht auffallen. Vielleicht sprechen und kleiden wir uns deshalb alle ähnlich.
Sieht so aus, als wäre uns die virtuelle Welt wichtiger als das reale Leben. Vielleicht ist das auf dem Land anders, aber in Hamburg kommt es fast nie vor, dass ein Freund vor deiner Haustür steht, klingelt und fragt, was du gerade machst. Verabredungen werden über WhatsApp besprochen, und selbst dann hat manchmal keiner von beiden Lust aufzustehen, sich anzuziehen und zum anderen zu fahren. Dann bleibt es also doch nur beim Schreiben.
Die Zeit, die man früher in Hobbys investiert hat, verbringen wir inzwischen mit dem Handy oder vor dem Computer.
Hinzu kommen dann meist auch Hausaufgaben, und unter diesen leidet besonders die Freizeit der Gymnasiasten, da ihnen ein Jahr der Vorbereitung auf das Abitur genommen wurde. Im Idealfall soll ein gerade 18-Jähriger sein Abitur nämlich bereits bestanden haben und auch noch wissen, welchen Beruf er ausüben möchte. Doch wer weiß schon mit 18 ganz genau, was er für den Rest seines Lebens machen möchte?
Früher war das anders. Nicht unbedingt besser, aber anders. Berufswege waren häufig vorgezeichnet. Jungs wurden das, was der Vater war. Mädchen machten vielleicht noch eine kaufmännische Ausbildung. Viele junge Frauen kümmerten sich in der Ehe um die Familie.
Heute wissen die meisten Jugendlichen im Alter von 18 Jahren nicht einmal, wer sie überhaupt sind. Man hat auch wenig Möglichkeiten, das herauszufinden. Von Arbeitgebern wird ein geradliniger Lebenslauf gefordert, ohne Unterbrechungen und Abzweigungen, Gelegenheiten, sich auszuprobieren, gibt es kaum. Und wie soll man das unter ständiger Beobachtung der sozialen Medien auch schaffen? Ohne Handy oder Internet ist man heute allerdings "out", gehört nicht mehr dazu. Es ist schon fast gar nicht mehr möglich, sich der Medienwelt zu entziehen.
Im Berufsleben und in der Schule wird man jeden Tag damit konfrontiert. Aber ein falsches Bild kann dich nicht nur zum Gespött der Schule machen und deinen späteren Berufsweg verbauen. Also: Wie, bitte schön, soll man Individualität erlangen?
Und dann sagen die Eltern: "Ihr seht alle gleich aus. Tragt die gleichen Frisuren, die gleichen Klamotten." Und dann sitzt man in Hamburg in der U-Bahn, S-Bahn oder im Bus und redet so miteinander, wie es alle tun, und die älteren Leute regen sich auf über "Digger" und "Yolo".
Fanny Rudolphs, Klasse 10a, Private Stadtteilschule St. Georg
Lieber aufklären statt verbieten!
Soll auf Hamburgs Straßen ein Kopfhörerverbot eingeführt werden? „Bringt nichts“, sagt ein Schüler
Viele Menschen wollen auch während der Fahrt mit dem Fahrrad und als Fußgänger in der Stadt Musik hören und telefonieren. Heute kein Problem mehr dank Kopfhörer oder Knopf im Ohr. Nach Paragraph 23, Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung muss ein Verkehrsteilnehmer allerdings dafür sorgen, dass sein Gehör nicht durch Geräte beeinträchtigt wird. Wenn Musik im Ohr das Hörvermögen eines Verkehrsteilnehmers beeinträchtigt, ist das ein Verstoß gegen die Vorschrift und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.
Ein Verbot von Kopfhörern im Straßenverkehr würde meiner Meinung nach die Freiheit einer Person einschränken. Außerdem ist nicht bewiesen, dass das Hören von Musik im Straßenverkehr die Zahl der Unfälle steigen lässt. Unfallstatistisch wird nicht erfasst, wie viele Menschen aufgrund lauter Musik über Kopfhörer oder Ohrstöpsel verunglücken.
2014 sind auf Hamburgs Straßen 38 Menschen tödlich verunglückt, darunter elf Radfahrer. Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr 9854 Menschen in Hamburg, eine Zunahme von 4,3 Prozent im Vergleich zu 2013.
Das Argument, dass die Menschen, die mit Kopfhörer Musik hören, durch den Verkehr „schlafwandeln", ist meiner Meinung nach nicht haltbar. Mit diesem Argument könnte es auch müden und gestressten Fußgängern und Radfahrern verboten werden, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Zwar passieren die meisten Unfälle auf den Straßen, weil Verkehrsteilnehmer unaufmerksam sind, aber ich glaube, dass das hier keine Rolle spielt.
Anders sieht das Professor Reinhard Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Er weist auf die Gefahr von Stöpseln im Ohr und Kopfhörern im Straßenverkehr hin: „Sehen und Hören sind die wichtigsten Wahrnehmungssinne im Straßenverkehr. Durch das Musikhören können jedoch wichtige Warnsignale nicht wahrgenommen werden – ein unnötiges Unfallrisiko für die Verkehrsteilnehmer.“ Wichtige Warnsignale im Straßenverkehr seien Hupen Klingeln, Fahrzeuggeräusche wie ein herannahender Zug an einem Bahnübergang oder Motorengeräusche von Autos und Motorrädern. „Hört ein Verkehrsteilnehmer diese akustischen Signale nicht, kann dies zu unvorhersehbaren Handlungen wie beispielsweise dem plötzlichen Queren einer Straße führen und somit schnell zu einer gefahrvollen Situation werden“, so Hoffmann. Die Unfallchirurgen der DGU raten deshalb Autofahrern, Fahrradfahrern, Fußgängern oder Joggern, ganz auf Ohrstöpsel und Kopfhörer im Straßenverkehr zu verzichten.
Ich meine, Stress und Müdigkeit können auch ein Unfallrisiko darstellen. Viele Menschen entspannen sich dagegen bei Musik oder nutzen sie als Motivation für den anstrengenden Tag.
Jeder, der gern Musik hört, sollte das auch mit Hilfe von Kopfhörern tun dürfen, selbstverständlich, ohne dabei andere zu stören oder zu gefährden. Wenn Politiker dieses Verbot nun durchsetzen, könnten sie alle Dinge, die uns auf den Straßen vom Verkehrsgeschehen ablenken können wie Essen und Trinken verbieten. Aber niemand will andere Menschen gefährden. Also ist das Verbot von Kopfhörern und Ohrstöpseln unsinnig.
Dass aber ein Verbot außerdem auf längere Zeit nichts bringen wird, zeigen die vielen Situationen, in denen Autofahrer trotz Handyverbots am Steuer weiterhin telefonieren und Fahrradfahrer sich nicht an das Rechtsfahrgebot halten.
Statt ein Verbot einzuführen, woran sich ohnehin nicht alle halten würden, sollten die Politiker lieber eine bundesweite Aufklärungskampagne starten. Die Versicherungen könnten dem Trend ein Ende setzen, indem sie bei einem durch einen Kopfhörer verschuldeten Unfall Leistungen streichen oder Beiträge erhöhen. Trotz dieser Maßnahmen sollte dennoch jeder Mensch auf seine und die Gesundheit anderer achten.
Gerrit Kleinfeld, Klasse 10a, Private STS St. Georg
Im Millerntor-Stadion bin ich der zwölfte Spieler auf dem Platz
Wer in Hamburg nicht ins Millerntor-Stadion geht, hat definitiv was verpasst, sei es als Hamburger oder als Tourist. Wann immer der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion spielt - die Stimmung ist immer einzigartig. Verantwortlich dafür sind die einzigartigen Fans des Kiezclubs.
Das erste Mal war ich mit meinem Vater im Stadion. Er war es, der mich mit der "Familie" des FC St. Pauli vertraut gemacht hat. Das ist Jahre her. Damals war ich überwältigt von den Emotionen im Stadion. Obwohl ich noch sehr klein war, kann ich mich trotzdem noch ganz genau an alles erinnern. Die Fans stehen absolut hinter ihrer Mannschaft. Es geht nicht darum, ob sie gewinnt oder verliert. Das merkt man immer an der Stimmung im Stadion. Alle feiern zusammen. Sowas gibt es nur auf St. Pauli, zumindest kenne ich es von keinem anderen Verein. Alle feiern zusammen.
Inzwischen wurde am Stadion gebaut. Die Bauarbeiten begannen 2006. Das Millerntor-Stadion ist heute längst nicht mehr das kleine Kiezstadion. Seit der Fertigstellung der Gegengerade fasst das Stadion 29.063 Besucher, die zwischen 12.323 Sitzplätzen und 16.740 Stehplätzen wählen können. Aber fertig ist es noch immer nicht.
Das Millerntor-Stadion ist nicht mit dem HSV-Stadion, das heute Imtech-Arena heißt und bald wieder Volksparkstadion heißen wird, zu vergleichen. Vor allem nicht, wenn es um die Stimmung während der Spiele geht. Die ist auf St. Pauli weltweit einmalig.
Ich gehe immer wieder gerne ins Stadion, ab und zu auch noch mit meinem Vater. Wenn der St. Pauli verliert, kommen wir dann beide schlecht gelaunt nach Hause und das nicht, weil ich in der Pubertät bin und er gerade Stress hatte. Wir sind schlecht gelaunt, weil wir zu unserem Verein stehen und auch immer stehen werden. Aber wenn der FC St. Pauli mal gewinnt, dann sind die Fans in einem Ausnahmezustand. Alle tanzen, sind glücklich und singen bis zum Umfallen, was sie auch sonst immer tun, aber das ist was anderes.
Nach einem Sieg gehe ich auch meistens noch etwas essen, natürlich auf Kosten meines Vaters.
Johannes Meyer, Klasse 10b, Private STS St. GeorgV